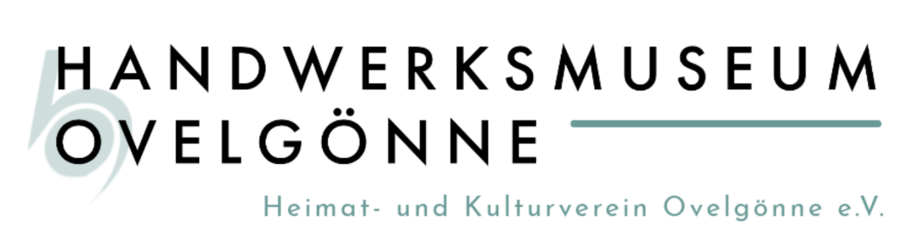
Über das Handwerksmuseum Ovelgönne
Das Handwerksmuseum Ovelgönne - Eine Schatzkammer der Wesermarsch
Willkommen im Handwerksmuseum Ovelgönne, einer einzigartigen Schatzkammer, die die reiche Geschichte der Wesermarsch zum Leben erweckt. Unser Museum befindet sich in einem liebevoll restaurierten, denkmalgeschützten Bürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert und bietet Ihnen einen faszinierenden Einblick in die Welt des Handwerks und der Gestaltung.
Tauchen Sie ein in vergangene Zeiten und entdecken Sie die vielfältigen Facetten des Handwerks. Das Museum präsentiert eine beeindruckende Sammlung von Exponaten, die die Geschichten und Errungenschaften der Handwerker vergangener Generationen erzählen. Von handgefertigten Werkzeugen bis hin zu kunstvoll gestalteten Handwerksprodukten - hier können Sie die handwerkliche Kunst vergangener Jahrhunderte bewundern.
Unser wunderschön restauriertes Bürgerhaus bietet die ideale Kulisse, um die Geschichte des Handwerks lebendig werden zu lassen. Jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte und lädt Sie ein, in vergangene Zeiten einzutauchen.
Ob Zimmermannswerkstatt, Schmiede oder Schneiderstube - hier können Sie die Atmosphäre vergangener Handwerkskunst hautnah erleben.
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen und Familien geeignet ist. Erkunden Sie unsere Dauerausstellung, nehmen Sie an einer faszinierenden Führung teil oder lassen Sie sich von unseren interaktiven Stationen begeistern. Für Kinder haben wir spezielle Aktivitäten und Workshops, bei denen sie spielerisch die Welt des Handwerks entdecken können.
Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist mehr als nur ein Ort der Geschichte. Es ist ein Ort des Lernens, der Begegnung und der Inspiration. Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen und die faszinierende Welt des Handwerks zu erkunden.
Tauchen Sie ein in die Geschichte der Wesermarsch und lassen Sie sich von der handwerklichen Meisterschaft vergangener Zeiten begeistern.
Zur Geschichte des Museums
Das Handwerksmuseum Ovelgönne wurde 1981 auf Initiative des damaligen Gemeindedirektors Ingo Hashagen gegründet.
Obwohl die Sammlung von Anbeginn vorwiegend aus Objekten des Handwerks bestand, rangierte das Museum zunächst als ‚heimatkundliche Sammlung‘.
Die erste Präsentation der Objekte wurde in dem jetzigen Bürgerhaus (Typ Oldenburger Giebelhaus) dem Hauptgebäude - in Ovelgönne ausgestellt und seitdem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Der Advokat und Landgerichtspedell Rumpf hatte das Gebäude im Jahre 1773 errichten lassen.
Es steht heute unter Denkmalschutz und feiert 2023 sein 250-Jubiläum.
2000 übernahm der Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e. V. die Trägerschaft des Museums von der Gemeinde Ovelgönne.
Seitdem wurde eine Modernisierung des Museums durch einen 85-köpfigen Verein bemerkenswertes Engagement auf den Weg gebracht.
Die Sanierung des Hauptgebäudes wurde mit dem Entkernen des Hauses und dem schrittweisen Aufbau der Grundplatte bis zur Dachspitze durchgeführt.
Ein neues Nebengebäude wurde errichtet, in der die voll funktionsfähige Schmiede untergebracht wurde.
Der kombinierte Ausstellungs- und Werkstattraum sowie ein weiterer Raum, welcher für Ausstellungen,
Museumspädagogik und Veranstaltungen genutzt wird, wurde ebenfalls neu eingerichtet.
Es ergibt sich somit die Möglichkeit, dem Bildungsauftrag des Museums auch im Rahmen einer erweiterten Öffentlichkeitsarbeit gerecht zu werden.






